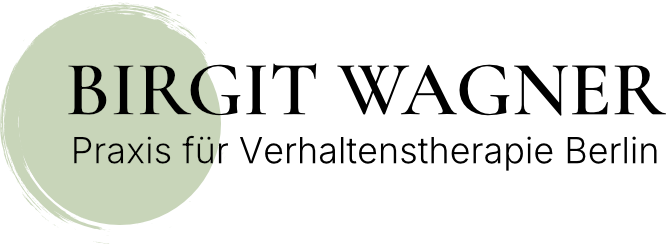Jedes Jahr versterben ca. 10.000 Personen in Deutschland durch einen Suizid und jeder Suizid hinterlässt Menschen, die durch den Suizid direkt oder indirekt betroffen sind. Der Suizid eines nahestehenden Menschen stellt eine der tiefgreifendsten psychischen Belastungen für Angehörige dar.
Die Suizidhinterbliebenen sehen sich häufig mit einer Vielzahl komplexer emotionaler, körperlicher und sozialer Reaktionen konfrontiert, die den Trauerprozess wesentlich erschweren können. Die Literatur weist darauf hin, dass diese Form des Verlustes mit einem deutlich erhöhten Risiko für psychische Störungen einhergeht, darunter Depressionen, die posttraumatische Belastungsstörung sowie die anhaltende Trauerstörung.
Trauer nach einem Suizid
Die Trauer nach einem Suizid ähnelt in vielen Aspekten der Trauer bei anderen Todesarten, beinhaltet jedoch zusätzliche belastende Gefühle.
Neben allgemeinen Trauerreaktionen wie Traurigkeit, Sehnsucht und Trennungsschmerz erleben Hinterbliebene oft:
- Schuldgefühle,
- ein Gefühl von Mitverantwortung,
- Sinnfragen,
- Wut,
- ein erhöhtes Suizidrisiko und
- soziale Stigmatisierung.
Häufig gehen dem Suizid familiäre Belastungen wie psychische Erkrankungen oder Konflikte voraus, die den Trauerprozess erschweren.
Schuldgefühle und Verantwortungszuschreibung
Schuldgefühle und Verantwortungszuschreibungen treten häufig nach dem Verlust einer nahestehenden Person durch einen Suizid auf. Hinterbliebene leiden beispielsweise unter Selbstvorwürfen, die Ernsthaftigkeit der Situation des Suizidenten nicht richtig eingeschätzt zu haben oder vielleicht selbst Anlass für die suizidale Handlung gewesen zu sein, wie beispielsweise durch eine Trennung oder vorangegangene Konflikte mit der verstorbenen Person. Trauernde werfen sich vor eventuelle Warnsignale bei ihrem Angehörigen übersehen zu haben, und dass sie den Suizid hätten verhindern können.
Schuldgefühle stehen eng in Zusammenhang mit Bedauern über die Beziehung, in der Themen vielleicht nicht angesprochen werden konnten oder einem Gefühl versagt zu haben (z.B. als Elternteil, Lebenspartner). Durch die häufig persistierenden Schuldgefühle ziehen sich die Angehörigen von sozialen Kontakten zurück, insbesondere dann, wenn die soziale Umwelt sie ebenfalls meidet und ihnen aus dem Weg geht. Die Wahrnehmung, dass das eigene Versagen auch von der sozialen Umwelt so beurteilt wird, verstärkt das Scham- und Stigmatisierungserleben der Hinterbliebenen.
Darüber hinaus entstehen Schuldgefühle auch durch die übersteigerte Selbsteinschätzung der eigenen Einflussmöglichkeiten zum damaligen Zeitpunkt und sind gleichzeitig auch immer sekundäre Bewertungen, die im Nachhinein über ein vergangenes Ereignis abgegeben werden. Das heißt, die Schuldgefühle generieren sich aus einer aktuellen Logik über die damaligen Geschehnisse heraus.
Unterstützungsbedarf und therapeutische Begleitung
Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt die psychosoziale Nachsorge von Angehörigen nach einem Suizid einen wesentlichen Bestandteil der Suizidprävention dar. Die therapeutische Begleitung sollte folgende Aspekte berücksichtigen:
- Anerkennung und therapeutische Bearbeitung der komplexen emotionalen Dynamik, wie beispielsweise das Erleben von Schuld, Scham und Wut
- Aufklärung und Informationen über suizidales Erleben und Verhalten, das zu dem Suizid des Angehörigen führte
- Förderung individueller Ressourcen und Integration des Verlusts in die Lebensbiografie.
- Empfehlung von Selbsthilfegruppen wie AGUS e. V., die gezielt Suizidhinterbliebene begleiten.
Fazit
Der Suizid eines nahestehenden Menschen stellt einen schwerwiegenden Einschnitt im Leben der Hinterbliebenen dar. Die Trauer ist oft mit spezifischen psychischen, körperlichen und sozialen Belastungen verbunden, die einer differenzierten therapeutischen Begleitung bedürfen. Neben psychotherapeutischer Unterstützung kann insbesondere die gesellschaftliche Enttabuisierung des Themas einen wertvollen Beitrag zur Entlastung der Betroffenen leisten.
Literaturempfehlung:
Wagner, B., & Hofmann, L. (2020). Psychische Folgen und psychotherapeutische Unterstützung nach dem Suizid eines Angehörigen. Psychotherapeut, 1(2020), 26-33.